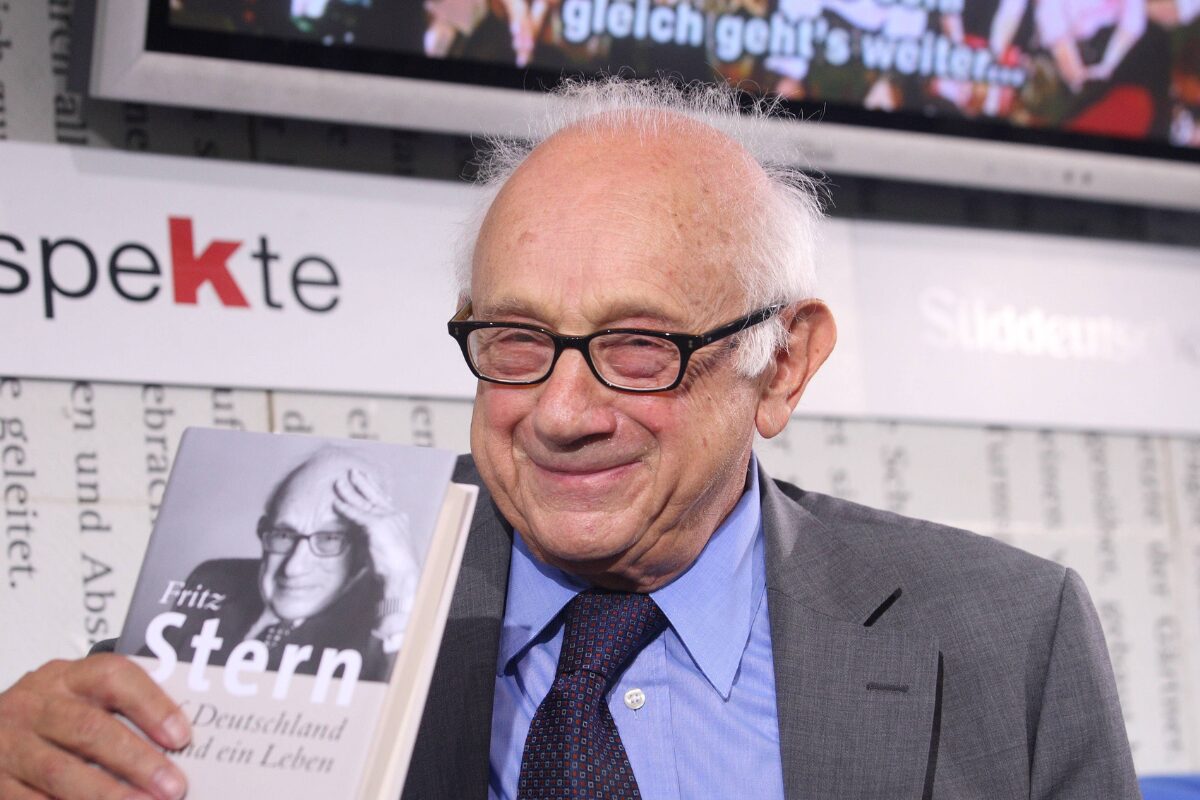Freiheit grenzenlos!? Zum Verhältnis von Liberalismus und Christentum

Das Verhältnis zwischen Christentum und Liberalismus ist historisch spannungsreich. Und heute? Einerseits werden religiöse Narrative von jenen, die den Liberalismus zu Fall bringen wollen, instrumentalisiert – andererseits können christliche Perspektiven wichtige Beiträge zur Bewältigung aktueller Krisen liefern.
In einer gut besuchten Katholischen Akademie diskutierten die französische Philosophin Chantal Delsol und der Frankfurter Religionsphilosoph Thomas M. Schmidt. Jarosław Kuisz moderierte die Veranstaltung, die die zweite unserer Reihe „Der Liberalismus und seine Kritiker“ ist und unser vom BMFTR gefördertes Verbundprojekt „Vordenker der liberalen Moderne“ begleitet.
Gleich zu Anfang wurde klar: Das Verhältnis von Christentum und Liberalismus ist ein ambivalentes, historisch existierten immer schon sowohl Gegnerschaft als auch Partnerschaften: Wurden im Zuge der Aufklärung zahlreiche Dogmen und Glaubensüberzeugungen des Christentums von den Vertretern einer liberalen Weltanschauung infrage gestellt und sogar mit ihnen gebrochen, trat andererseits schon früh das Christentum, insbesondere in seiner institutionellen Form als Kirche, als Kritiker des Liberalismus auf und wiesen christliche Denker auf die blinden Flecken des Liberalismus hin.
Inzwischen werden liberale Grundrechte, die Demokratie und die Menschenrechte von den Kirchen anerkannt und befürwortet. Bei anderen zahlreichen Fragen aber bestehen weiterhin Spannungen. Man denke an aktuelle Kontroversen zu bioethischen Themen, zur Sexualethik oder bei Fragen rund um Gender und Familie.
Ursprung und Krise des Liberalismus
Chantal Delsol verortete Aufklärung und Liberalismus, wie häufig verkürzt dargestellt, nicht als reine Gegenbewegung zum Christentum, sondern stellte beides in eine über die Theorie der Moderne hinausweisende lange geistesgeschichtliche Tradition. Liberalismus trete in „einem kulturellen Feld zum Vorschein, das durch das vom Judentum sich herleitende Christentum geprägt ist.“ Delsol kam zum Schluss, der Liberalismus sei somit „Frucht der Anthropologie der Person“.
Die Idee der individuellen Freiheit sei damit eine, die sich nicht in erster Linie in Opposition zu einem religiös geprägten Weltverständnis herausgebildet habe. Im Gegenteil: Sie sei von Anfang an religiös eingebettet gewesen. Und: Freiheit könne nie ohne Verantwortung gedacht werden. Sie sagte: „Es gibt keine Freiheit ohne die Idee ihrer zugleich hingenommenen und hinzunehmenden Schranken. In ihrem Ursprung beruht Freiheit also auf klar bestimmten Grundlagen und geht mit Bedingungen einher.“ In dieser Verwurzelung sei der ursprüngliche Liberalismus auch weiterhin tragfähig.
Problematisch werde der Liberalismus jedoch in der Moderne, wenn er sich von diesen religiösen und moralischen Fundamenten löse. Dann erscheine Freiheit „einer weit klaffenden Leere ausgesetzt“. Delsol sprach von einem „Nihilismus“, der in der heutigen Kultur die Überzeugung nähre, „dass alles möglich ist“.
Als Beispiel dafür nannte sie gesellschaftliche Debatten wie jene um den assistierten Suizid: Für sie ein Beispiel dafür, wie absolute Selbstbestimmung ohne Maß und Bindung in moralische Orientierungslosigkeit führe. Die Lösung? Sieht Chantal Delsol nicht etwa in einer einfachen Rückkehr in vormoderne Ordnungen. Sie unterstrich: „Wir können nicht in die Vergangenheit zurück“. Vielmehr plädierte sie dafür Ihr Anliegen, innerhalb der Moderne eine christlich geprägte Anthropologie starkzumachen, die Sterblichkeit und Verantwortlichkeit ernst nimmt. Damit könne sie Orientierung jenseits vom „postmodernen Relativismus“ bieten.
Abwehrreaktion und Voraussetzungen des Liberalismus
Thomas M. Schmidt stimmte in seiner Replik vielen Thesen Delsols zu. Aber er erweiterte ihre Perspektive noch um eine politische Dimension: Liberalismus sei zwar inspiriert durch christliche Anthropologie, aber nicht allein darauf zu reduzieren. Vielmehr sei er zugleich „eine politische Abwehrreaktion […] auf den gesellschaftlichen Monopolanspruch der Religion“. Der weltanschaulich neutrale Staat sei als Lehre aus den Religionskriegen entstanden. Diese hätten eine Trennung von politischer Ordnung und religiöser Vormachtstellung notwendig gemacht.
Schmidt griff das bekannte Diktum des Verfassungsrichters und Rechtsphilosophen Ernst-Wolfgang Böckenfördes auf: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist.“
Damit betonte er, dass Freiheit auf inneren moralischen Ressourcen basiert, die weder vom Staat geschaffen noch erzwungen werden können. Dies sei „das große Wagnis“ des Liberalismus, das dieser „um der Freiheit willen“ eingehe. Schmidt warnte zugleich davor, eine einheitliche religiöse Grundlage für die Gesellschaft zu fordern: „Weltanschauungen sind in der Tat unverzichtbare Ressourcen der Orientierung. Aber es gibt Weltanschauungen nur im Plural.“ Ein moderner Rechtsstaat könne daher nicht auf eine einzelne Religion verpflichtet werden, ohne seine Freiheitlichkeit zu verlieren.
Besonders würdigte Schmidt Delsols Verständnis der gegenwärtigen Rolle des Christentums. Er erklärte: „Das Christentum sollte vielmehr still und solidarisch präsent sein an jenen Orten, an denen Individuen die Freiheit liberaler Gesellschaft eben nicht nur als Emanzipation und Bereicherung erleben, sondern auch als Entfremdung und Einsamkeit.“ Er interpretierte die christliche Anthropologie in diesem Zusammenhang als „Schule der empathischen Wahrnehmung des Anderen, gerade des verletzten Anderen.“
Konfliktreiche Vergangenheit, spannungsreiche Zukunft
Beide Diskutanten einte die Überzeugung, dass Liberalismus ohne moralische Substanz nicht bestehen könne. Sie betonten, dass das Christentum eine Ressource sein kann, um Freiheit menschlich zu erden. Doch während Delsol stärker den Verlust gemeinsamer Grundlagen betonte, plädierte Schmidt für eine Reform des Liberalismus im Rahmen einer pluralistischen Moderne.
Welche Ressourcen also kann das Christentum heute bieten? Kann es Orientierung bieten, um einer grenzenlosen Ausweitung der Freiheiten etwas entgegenzusetzen? Skepsis herrschte darüber, ob das Christentum angesichts seines Bedeutungsverlustes in Europa tatsächlich noch eine gemeinsame normative Basis liefern könne. Statt Freiheit und Verantwortung miteinander zu verschränken, könne ein solches Vorhaben auch Gefahr laufen, das Christentum zu verabsolutieren. Welche Dynamiken dies entfachen kann, sieht man aktuell am christlichen Postliberalismus in den USA, der sich zu einer ernsthaften Bedrohung der liberalen Demokratie entwickelt hat.

![]()
Hat Ihnen unser Beitrag gefallen? Dann spenden Sie doch einfach und bequem über unser Spendentool. Sie unterstützen damit die publizistische Arbeit von LibMod.
Spenden mit Bankeinzug
Spenden mit PayPal
Wir sind als gemeinnützig anerkannt, entsprechend sind Spenden steuerlich absetzbar. Für eine Spendenbescheinigung (nötig bei einem Betrag über 200 EUR), senden Sie Ihre Adressdaten bitte an finanzen@libmod.de
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Mit dem LibMod-Newsletter erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu unseren Themen in Ihr Postfach.