Ralf Fücks im Interview von Focusplus „Dann fährt ökologische Politik an die Wand“
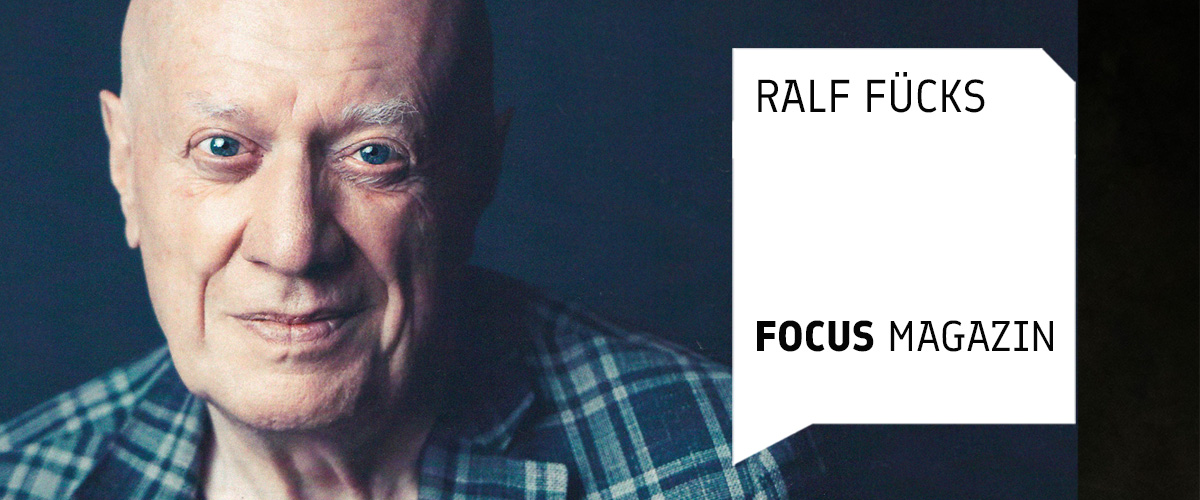
Inmitten der angespannten Weltlage tritt der Klimawandel in den Hintergrund. Mit fatalen Folgen. Es braucht einen neuen Anlauf, damit die Energiewende breit akzeptiert und sozial-ökonomisch umgesetzt wird, erklärt Ralf Fücks im Interview mit Focus und meint: Wir müssen zeigen, wie Umweltschutz und Wohlstand zusammengehen.
Herr Fücks, in 20 Jahren wollen wir hierzulande klimaneutral sein, kein CO2 mehr ausstoßen. Die Bundesregierung ist dafür nicht auf dem richtigen Pfad, oder?
Wir sind nicht auf Kurs, bis 2045 klimaneutral zu werden, vor allem im Verkehrs- und Gebäudesektor. Auch beim Ausbau der Stromnetze hängen wir hinterher. Klimapolitik zählt bisher nicht zu den Prioritäten der neuen Koalition. Es fehlt der grüne Motor in der Regierung. Aber: den bisherigen Kurs einfach fortzusetzen, würde auch mit den Grünen nicht funktionieren. Wir brauchen einen neuen Anlauf in der Klimapolitik.
Warum?
Die Prioritäten haben sich verschoben. Sorge vor wirtschaftlichem Abstieg, unkontrollierter Migration und Krieg treiben die Menschen stärker um. Ich beobachte das auch bei mir: Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten schieben sich vor die Klimakrise. Gleichzeitig ist die wirtschaftliche Lage eine ganz andere als vor vier oder fünf Jahren, als Klimapolitik noch hoch im Kurs stand. Die Kostenfrage spielt jetzt eine ganz andere Rolle. Wenn man das nicht realisiert, fährt ökologische Politik gegen die Wand.
Hat Klimapolitik auf lange Sicht das Nachsehen?
Das hätte katastrophale Folgen. Deshalb brauchen wir einen neuen Anlauf in der Klimapolitik. Sie hat nur eine Chance auf Erfolg, wenn sie auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Wir haben eine Menge anderer struktureller Probleme, aber auch Klimapolitik muss sich stärker an Fragen der Wirtschaftlichkeit orientieren. Nehmen wir die Energiekosten: Sie sind Wettbewerbsfaktor und gleichzeitig eine soziale Frage für relevante Teile der Bevölkerung. Klimaneutralität, Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit bedingen sich gegenseitig.
Das bedeutet auch, dass sie es unter der Ampel nicht mehr waren.
Wir erleben jetzt die Stunde der Wahrheit bei den Kosten der Energiewende.
Zu dieser Wahrheit gehört auch, dass der abrupte Stopp russischer Gaslieferungen die Energiekosten in die Höhe trieb. Aber: Kein Demokrat kann zurückwollen zu Gaslieferungen, die uns abhängig von Russland machen und einen Angriffskrieg finanzieren.
Kurzum: Die Energiewende ist teuer.
Wir sind lange dem Credo gefolgt: „Sonne und Wind schicken keine Rechnung.“ Die Energiewende sollte dazu führen, dass Energie immer billiger wird. Das hat sich als Illusion entpuppt. Die Systemkosten sind hoch, der Investitionsbedarf gewaltig: Stromnetze und Speicher, Back Up-Kraftwerke, Pipelines für Wasserstoff und CO2, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, Sanierung des Gebäudebestands, Umbau der Industrie. Folgt man einschlägigen Studien, erfordert die Klimawende bis 2045 Investitionen von rund 11 Billionen Euro, etwa 540 Milliarden im Jahr. Die Frage ist: rentieren sich diese Investitionen durch höhere Produktivität und Wertschöpfung? Und wenn nicht: Wer finanziert die Kostenlücke? Können die öffentlichen Haushalte das leisten? Und wie mobilisieren wir mehr privates Kapital für grüne Investitionen? An diesen Fragen muss intensiver gearbeitet werden.
Die Energiewende gelingt nur, wenn ihr Preisschild passt.
Sie gelingt nur, wenn sie breit akzeptiert wird und wir die Kosten im Griff behalten. Bislang herrschte ein Mangel an Pragmatismus. Wir brauchen Übergangslösungen, damit der Wandel gelingt, etwa beim Wasserstoff oder Biokraftstoffen. Wenn wir darauf beharren, dass ihre Klimabilanz von Anfang an perfekt sein muss, treiben wir die Kosten hoch und verzögern den Hochlauf. Auch die überbordende Detailsteuerung, das Dickicht an Vorgaben und Regulierungen muss gelichtet werden. Sonst verstärken wir die Abwehrreflexe bei Unternehmen und Bürgern nach dem Motto: „Lasst uns endlich in Ruhe unser Ding machen“.
Sie klingen fast wie ein Wirtschaftsboss.
Ich bin Verfechter einer öko-sozialen Marktwirtschaft. Wir brauchen die Innovations- und Investitionskraft der Unternehmen. Wenn der Wirtschaftsmotor stottert, stockt auch die Klimawende. Und wenn der Wohlstand einbricht, verlieren wir den Rückhalt in der Gesellschaft. Zum neuen klimapolitischen Realismus gehört auch: Die nötigen Veränderungen sind so groß, dass sie nicht aus dem laufenden Haushalt finanziert werden können. Mit der bisherigen Schuldenbremse ist das nicht zu machen. Wir müssen gewaltig investieren und ehrlich kommunizieren: Klimaneutralität hat ihren Preis. Und, ja, Energie und Mobilität werden teurer werden.
Das schafft neue soziale Härten. Die Ampel-Parteien hatten sich ein Klimageld in den Koalitionsvertrag geschrieben, mit dem die Menschen entlastet werden sollten. Schwarz-Rot erwähnt es nicht einmal mehr.
Wir werden aber eine Kompensation für steigende CO2-Preise brauchen . Insbesondere Haushalte mit niedrigen Einkommen müssen entlastet werden. Sonst bricht uns die Akzeptanz weg und die AfD räumt ab.
Es scheint, als ob das Pendel nun zurückschlägt, von der Ökologie zur Ökonomie. Haben die Menschen genug vom Klimaschutz – oder sind sie ermattet von den vielen Krisen?
Das Problem ist die Gleichzeitigkeit, mit der alle möglichen Krisen auf die Gesellschaft einprasseln – und die permanenten Katastrophen-Szenarien. Die Menschen wachzurütteln, in denen man ihnen einhämmert, die Welt gehe unter, geht nach hinten los. Wenn der Rückhalt für Klimaschutz wieder wachsen soll, muss man zeigen, wie es erfolgreich geht.
Seit dem Pariser Klimabkommen sind nun zehn Jahre vergangen, das 1,5‑Grad-Ziel ist in weiter Ferne. Hat der Klimawandel seinen Schrecken verloren?
Allen informierten Zeitgenossen ist klar, dass wir das 1,5‑Grad-Ziel reißen werden. Trotz der beachtlichen Senkung der CO2-Emissionen in Europa und dem raschen Wachstum der erneuerbaren Energien ist die Welt auf einem Kurs Richtung 3 Grad. Das muss nicht das letzte Wort sein, eine Begrenzung auf 2 Grad ist noch machbar. Dafür müssen die globalen Emissionen rasch sinken. Parallel müssen wir der Atmosphäre im großen Stil CO2 entziehen. Aber selbst dann wird eine stärkere Anpassung an die Erderwärmung nötig – was mit weiteren Kosten verbunden ist. Wir müssen uns klimapolitisch ehrlich machen: mit Blick auf die Kosten, die Zielkonflikte, die absehbare Entwicklung. Wir brauchen eine realistische Klimakommunikation, ohne resignativ oder fatalistisch zu werden.
Es scheint, als hätten wir die Anstrengungen unterschätzt.
Das kann man so sagen. Es geht um den kompletten Umbau der Industriegesellschaft im globalen Maßstab. Wir müssen unsere Energiebasis, Industrie, Landwirtschaft und Infrastruktur erneuern und dabei die Gesellschaft mitnehmen. Das ist ein enormer Kraftakt.
Davon zeugt das Gebäudeenergiegesetz, das Wirtschaftsminister Robert Habeck und sein später entlassener Staatssekretär Patrick Graichen voranbrachten. Es wurde als „Verbotsgesetz“ gebrandmarkt.
Die Intention des Gesetzes war richtig. Ohne den Gebäudebereich schaffen wir keine Klimawende. Es war auch richtig, die Botschaft zu senden: Setzt euch keine neue Gasheizung in den Keller. Gas wird mit dem steigenden CO2-Preis elend teuer. Aber es fehlte die Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung: Wo setzen wir künftig auf Fernwärme, wo ist die Wärmepumpe die bessere Lösung? Die Kostenbelastung für Hauseigentümer wurde unterschätzt. Und es gab es keine Sensibilität dafür, dass sich in der Gesellschaft eine Stimmung gegen staatliche Bevormundung aufgebaut hatte, die dann kräftig von antigrünen Populisten und Medien geschürt wurde. Das war Politik nach dem Motto: „Ich weiß, was richtig und nötig ist – und das ziehe ich jetzt durch.“ Dieser Politikstil ist gründlich gescheitert.
Die abgezahlten Atomkraftwerke rechneten sich wohl auch für die Stromkunden. War der Atomausstieg ein Fehler?
Zumindest der Zeitpunkt des Ausstiegs war irrational. Mitten in einer Energiekrise mit steigenden Preisen wurden kostengünstige, zuverlässig liefernde Kraftwerke vom Netz genommen. Das hat den Grünen den Ideologieverdacht zurückgebracht, den sie schon weitgehend abgeschüttelt hatten.
Haben die Grünen eigentlich verstanden, dass ihre Klimapolitik eine Neuausrichtung braucht?
Das erfordert den Mut zu unbequemer Wahrheiten. Nehmen wir den Stromsektor: Wir können es uns nicht mehr leisten, Wind- und Solarstrom unabhängig vom Netzausbau und der Stromnachfrage zu fördern. Die Produzenten erhielten bisher ihre garantierte Vergütung sogar bei negativen Strompreisen. Das treibt den staatlichen Zuschuss in die Höhe – im letzten Jahr etwa 18,5 Milliarden Euro. Zusätzlich zahlt der Bund jährlich einen Milliardenbetrag, um Betreiber für nicht genutzten Strom entschädigen. Das EEG hat seinen Zweck erfüllt, die Lernkurve für die erneuerbaren Energien zu finanzieren und sie marktfähig zu machen. Was wir jetzt fördern müssen, ist der Netzausbau, gesicherte Leistung und eine bessere Koordination von Angebot und Nachfrage.
Die Partei hadert mit ihrem Kernthema. Vor Jahren gingen für den Klimaschutz Millionen Menschen auf die Straße. Die Jugend wählte grün. Wann haben die Grünen eigentlich die Jugend verloren?
„Die Jugend“, das ist mir zu pauschal. Was wir beobachten, ist eine wachsende Drift zu den politischen Rändern. Vor allem junge Männer gehen verstärkt nach rechts, junge Frauen eher nach links. Dagegen fehlt den Grünen eine mitreißende Fortschrittserzählung, die politischen Pragmatismus mit dem Mut zur Veränderung verbindet. Es hat etwas tragisches, dass den Grünen ausgerechnet ihre klimapolitischen Ambitionen auf die Füße fallen: den einen sind sie nicht radikal genug, den anderen zu radikal.
In Lützerath demonstrierte die junge grüne Basis 2023 gegen den Ausbau des dortigen Tagebaus, leistete Widerstand gegen die Polizei. Das mag einen Bruch erzeugt haben…
Nicht in der Breite. Aber es ist ein Problem, wenn Konflikte wie dieser symbolisch so aufgeladen werden, als hänge die Zukunft von ihnen ab. All diese Narrative: „Wir haben noch zehn, neun, acht Jahre Zeit, um den Planeten zu retten“ erzeugen Fatalismus auf der einen, Radikalismus auf der anderen Seite.
… während viele Menschen im Land ein feines Gespür dafür haben, ob sie Anstrengungen leisten und der Rest der Welt nicht.
Nüchtern betrachtet entscheidet sich die Zukunft des Klimas in Asien, Afrika und Lateinamerika. Dort leben die meisten Menschen, dorthin verlagert sich der Schwerpunkt der Weltwirtschaft. China allein stößt ein Drittel der globalen CO2-Emissionen aus. Das heißt aber nicht, dass egal ist, was wir tun. Wir können Vorreiter auf dem Weg zur Klimaneutralität sein und zeigen, wie Umweltschutz und Wohlstand zusammengehen. Was wir machen, muss anschlussfähig für den großen Rest der Welt sein. Angesichts des Rückschritts in den USA sollten wir jetzt erst recht Klimaallianzen mit anderen Industrie- und Entwicklungsländern bilden.
Hat Ihnen unser Beitrag gefallen? Dann spenden Sie doch einfach und bequem über unser Spendentool. Sie unterstützen damit die publizistische Arbeit von LibMod.
Spenden mit Bankeinzug
Spenden mit PayPal
Wir sind als gemeinnützig anerkannt, entsprechend sind Spenden steuerlich absetzbar. Für eine Spendenbescheinigung (nötig bei einem Betrag über 200 EUR), senden Sie Ihre Adressdaten bitte an finanzen@libmod.de
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Mit dem LibMod-Newsletter erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu unseren Themen in Ihr Postfach.





