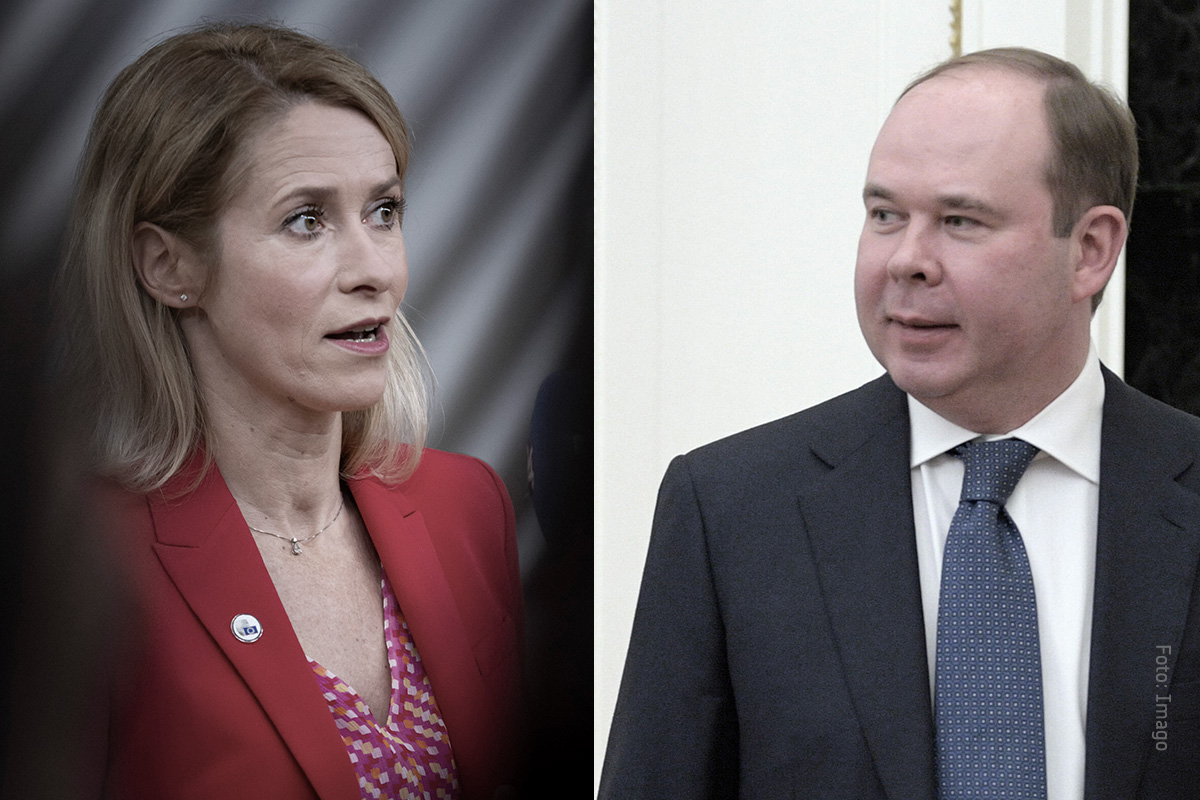Helsinki 1975 – Als die Menschenrechtsbewegung Weltpolitik machte

Vor 50 Jahren wurde die KSZE-Schlussakte in Helsinki unterzeichnet. Das Dokument sollte den Kalten Krieg mit dem Prinzip der „friedlichen Koexistenz” entschärfen, indem es die sowjetische Kontrolle über Osteuropa legitimierte. Unerwartet aber setzte es etwas in Gang, was die kommunistischen Regime ins Wanken brachte: Es machte Menschenrechte zu einem Faktor internationaler Politik, schreibt Sergej Lukaschewski.
Vor einem halben Jahrhundert unterzeichneten die Länder des „sozialistischen Lagers” und ihre geopolitischen Gegner im Westen die Helsinki-Abkommen. Diese Vereinbarung legitimierte de facto die Teilung Europas und überließ den Osten des Kontinents der Sowjetunion. Gleichzeitig machte die Helsinki-Schlussakte die Menschenrechte zu einem Teil der internationalen Politik, was später zum Sturz der kommunistischen Regime beitrug und Menschenrechtsaktivisten zu Akteuren der internationalen Politik machte.
Oft heißt es, die Schlussakte von Helsinki habe neue Prinzipien internationaler Politik festgelegt und einen auf Anerkennung der Menschenrechte basierenden Frieden gesichert. Das ist jedoch nur teilweise richtig. Die 15 Jahre Frieden in Europa nach der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte waren das Ergebnis eines Kräftegleichgewichts und der Zustimmung der Parteien zum bestehenden Status quo. Die Abkommen haben dies lediglich auf Papier festgeschrieben.
Als die Krise und der Zusammenbruch der kommunistischen Regime die Welt aus dem Kalten Krieg befreiten, konnten die Helsinki-Prinzipien und ‑Mechanismen bewaffnete Konflikte nicht verhindern: vom Krieg in Jugoslawien bis zur russischen Aggression gegen die Ukraine.
Die Helsinki-Abkommen haben der Entwicklung der Menschenrechtsbewegung einen enormen Impuls gegeben. Das war jedoch ein unvorhergesehener Nebeneffekt, der nicht von Politikern, sondern von mutigen Aktivisten erreicht wurde.
Legitimierung der Sowjetherrschaft in Osteuropa
Anfang der 1970er Jahre suchten die USA und die westeuropäischen Länder auf der einen und die Sowjetunion auf der anderen Seite nach Wegen, um ihre gegenseitige Konfrontation und das Wettrüsten zu entschärfen. In der Sowjetunion zeigten sich erste Anzeichen einer systemischen Krise. Das Wirtschaftswachstum halbierte sich, die Militärausgaben beliefen sich auf 15 Prozent der Wirtschaftsleistung.
Die westlichen Volkswirtschaften litten zu dieser Zeit unter Stagflation (kaum Wachstum bei steigenden Preisen), steigenden Schulden und Arbeitslosigkeit. Die USA steckten im brutalen Vietnamkrieg fest und verloren an militärischem und moralischem Ansehen. 1971 gab Präsident Richard Nixon ohne Vorwarnung an die Verbündeten die Goldbindung des Dollars auf und führte 10-prozentige Einfuhrzölle ein. Die Kurse der japanischen und europäischen Währungen stiegen gegenüber dem Dollar, was ihre Volkswirtschaften hart traf. Zu allem Überfluss kam es 1973 infolge des arabisch-israelischen Jom-Kippur-Krieges zu einer Ölkrise. Die arabischen Golfstaaten provozierten einen vierfachen Anstieg der Ölpreise.
Zu diesem Zeitpunkt übertrafen die in Mitteleuropa stationierten sowjetischen Truppen die NATO-Streitkräfte um 20 Prozent an Mannstärke und um das Dreifache an Panzern, Artillerie und anderem Gerät. Das relative militärische Gleichgewicht wurde nur durch Atomwaffen erreicht.
Die Situation war sogar noch gefährlicher als die heutige Bedrohung Europas durch Putins Russland. Aber die damalige sowjetische Führung strebte keine neuen Eroberungen mehr an. Sie wollte den Status quo erhalten, der durch riesige, gegeneinander aufgestellte Armeen inmitten Europas gesichert war.
Aus politischer Sicht war die Lage jedoch nicht so eindeutig. Am Ende des Zweiten Weltkriegs verfügte die Sowjetunion nicht nur über die mächtigste Landarmee der Welt, sondern kontrollierte direkt oder indirekt auch die Hälfte Europas. Die 1945 auf den Konferenzen von Jalta, Potsdam und San Francisco unterzeichneten Dokumente gingen davon aus, dass die Völker Europas selbst über ihr Schicksal entscheiden würden und das besetzte Deutschland ein einheitliches Land bleiben würde.
In den Jahren 1946 bis 1949 etablierte Moskau mit Hilfe von Repressionen, Wahlfälschungen und politischen Umstürzen pro-sowjetische Regime in den meisten Ländern Europas, die unter seiner direkten militärischen Kontrolle oder seinem politischen Einfluss standen (der Warschauer Pakt). Darüber hinaus annektierte die Sowjetunion entlang ihrer Westgrenze ein Gebiet so groß wie Spanien – 485.000 Quadratkilometer, darunter die baltischen Staaten.
Während die Besetzung Deutschlands und die Grenzen Polens durch Abkommen zwischen der Sowjetunion, den USA und Großbritannien festgelegt wurden (Polen wurde nicht gefragt), basierten alle anderen territorialen und politischen Eroberungen auf dem Recht des Stärkeren.
Proteste in der DDR (1953), Polen (1956), Ungarn (1956) und in der Tschechoslowakei (1968) zeigten, dass die in diesen Ländern etablierten pro-sowjetischen Regime von der Bevölkerung nicht akzeptiert wurden. Die blutige Niederschlagung dieser Proteste zeigte, dass Moskau keine Veränderung der politischen Regime in diesen Ländern zulassen würde.
Bis Anfang der 1970er Jahre gelang es der UdSSR, in den Ländern des Warschauer Pakts politische Stabilität zu erreichen, die auf totalitärer Unterdrückung beruhte. Es fehlte nur noch die diplomatische Anerkennung. In Helsinki erhielt die Sowjetunion diese.
Der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew sah sich als Sieger. Erste Anzeichen für einen Verfall des sowjetischen Regimes waren für Außenstehende nicht erkennbar, während das neue Abkommen die sowjetische Kontrolle über halb Europa legitimierte und ihr Spielraum für weitere Rivalität mit Washington verschaffte.
Im Text der Schlussakte findet sich kein Hinweis auf eine „sowjetische Interessenzone” oder ähnliches. Im Gegenteil, der Vertrag verkündete einen Verzicht auf die Anwendung militärischer Gewalt, das Recht der Völker, selbst zu entscheiden, welche politische Ordnung in ihren Ländern herrschen soll und welchem Bündnis sie angehören wollen.
Alles Wesentliche wurde impliziert, aber nicht offen in den Verträgen verkündet. Nach Helsinki verzichteten die westlichen Länder auf die Unterstützung der freiheitlichen Bestrebungen der Völker Mitteleuropas und legitimierten die territorialen Eroberungen der Sowjetunion im Gegenzug für ihre eigene Sicherheit.
Das Abkommen verpflichtete beide Seiten, sich gegenseitig im Voraus über Truppenbewegungen in Europa zu informieren. Dies stärkte die Sicherheit Westeuropas, das faktisch eine Garantie für den Verzicht auf Krieg erhielt. Die USA, so der damalige US-Außenminister Henry Kissinger, seien den Europäern einfach „entgegen gekommen...“. Das Abkommen im Geiste der Realpolitik wurde als Erklärung für Frieden und Zusammenarbeit getarnt, die auf der Anerkennung der Gleichheit der Völker und dem Verzicht auf die Lösung von Konflikten mit Gewalt beruhte.
Um diesen Eindruck zu mildern, wurden die Abkommen durch Bestimmungen zur Achtung der Menschenrechte ergänzt. Der Kreml war von den zusätzlichen Verpflichtungen nicht begeistert, entschied aber letztlich, dass sie ebenso formal sein würden wie das nominelle Recht Bulgariens, aus dem Warschauer Pakt aus- und der NATO beizutreten. Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung war sich jedoch niemand sicher, ob dies überhaupt Auswirkungen auf die Zukunft haben würde.
Überwachung der Menschenrechte
Glücklicherweise wird die Zukunft nicht nur von Politikern gestaltet, sondern auch von ganz normalen Menschen. Als sowjetische Dissidenten den Text der Schlussakte lasen, sahen sie darin eine Chance. Sie hatten sich vergeblich an die Vereinten Nationen und die Weltgemeinschaft gewandt und darum gebeten, auf die politischen Repressionen und Menschenrechtsverletzungen in ihrem Land aufmerksam zu machen. Die Sowjetunion wies jede Kritik mit dem Verweis auf den Grundsatz der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten zurück.
Die Helsinki-Abkommen haben alles verändert. In einem Dokument wurden Fragen der Kontrolle von Truppenbewegungen und die Verpflichtung zur Achtung des Rechts auf freie Informationsverbreitung, der Gewissensfreiheit, der Rechte von Minderheiten und einiger anderer Rechte zusammengefasst.
Die Achtung der Menschenrechte wurde Teil der „Gesamtsicherheit”. Wenn die Sowjetunion einige Bestimmungen des Vertrags nicht einhält, wie kann man dann sicher sein, dass sie die übrigen einhält?
Im Mai 1976 wurde in der Wohnung des Wissenschaftlers Andrej Sacharow die Gründung einer Gruppe zur Förderung der Umsetzung der Helsinki-Abkommen bekannt gegeben. Später wurde sie als Moskauer Helsinki-Gruppe bekannt. Zum ersten Mal in der Geschichte erklärten hier normale Bürger, dass sie die Einhaltung internationaler Menschenrechtsverpflichtungen durch den Staat überwachen würden.
Später wurden ähnliche Vereinigungen in vielen Ländern gegründet – Helsinki-Gruppen in Sowjetrepubliken wie der Ukraine, Litauen, Armenien und Georgien, sowie „Charta 77“ in der Tschechoslowakei. Die amerikanische „Helsinki-Gruppe” entwickelte sich zu Human Rights Watch – einer der weltweit führenden Menschenrechtsorganisationen.
Trotz der Repressionen begannen Aktivisten in kommunistischen Ländern, Informationen über Menschenrechtsverletzungen zu sammeln und an ausländische Regierungen weiterzuleiten. Den westlichen Diplomaten blieb nur noch, den Ball aufzunehmen und ins Spiel zu bringen.
Ein unerwarteter Triumph
Die Helsinki-Abkommen konnten das Wettrüsten nicht stoppen. Im Dezember 1979 marschierten sowjetische Truppen in Afghanistan ein. Anfang der 1980er Jahre war die Gefahr eines Atomkrieges so groß wie nie zuvor seit der Kuba-Krise. Dennoch blieb die Diskussion über die Menschenrechtslage eines der Hauptthemen auf den KSZE-Konferenzen, die zur Weiterentwicklung des „Helsinki-Prozesses” geschaffen worden waren.
Menschenrechtsaktivisten und Vertreter nationaler Bewegungen schufen ein gemeinsames Narrativ des Kampfes für Demokratie, Völkerfreundschaft und Menschenrechte, das auf einem internationalen Dokument über kollektive Sicherheit basierte. Als sich der politische Kontext zu verändern begann, wirkte dieses Narrativ wie ein Rammbock, der die Legitimität der kommunistischen Regime zerstörte.
Mitte der 1980er Jahre war die Krise in der Sowjetunion bereits so tiefgreifend, dass es unmöglich wurde, den Status quo aufrechtzuerhalten und die Parität mit dem Westen zu wahren. Michail Gorbatschow versuchte, eine neue Entspannungspolitik vorzuschlagen, stieß jedoch auf die Forderung der USA und ihrer Verbündeten, dass Moskau zunächst seine Menschenrechtsverpflichtungen erfüllen sollte.
Als Befürworter einer Demokratisierung stellte Gorbatschow nach und nach die politischen Repressionen ein und entließ politische Gefangene, angefangen mit Andrej Sacharow. Doch ohne totalitären Zwang erwies sich das kommunistische Regime als nicht lebensfähig.
„Die Ohnmacht der Mächtigen”
Der Sturz der kommunistischen Regime in Europa, die Wiedervereinigung Deutschlands und der Zerfall der Sowjetunion ermöglichten es den westlichen Ländern, sich als Sieger von Helsinki 1975 zu sehen. Westliche Diplomaten erschienen nun als Weitsichtige, die einen genialen Plan für einen friedlichen Sieg im Kalten Krieg ausgeheckt hatten.
Die Helsinki-Abkommen wurden als universeller Schlüssel zu einem dauerhaften Frieden dargestellt. 1995 gründeten die Vertragsstaaten die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), um ihre Entschlossenheit zu demonstrieren, den gemeinsamen Sicherheitsraum auf der Grundlage gemeinsamer Werte nicht nur zu erhalten, sondern weiterzuentwickeln.
Aufmerksame Beobachter konnten jedoch bereits Anfang der 1990er Jahre feststellen, dass die Abkommen in einer Situation ernsthafter Konflikte wenig nützlich waren. Das Problem liegt in der Deklarativität der Abkommen – sie enthalten weder Sanktionen gegen Länder, die gegen sie verstoßen, noch Mechanismen zur Konfliktlösung. Die OSZE hat sich zu einem wichtigen diplomatischen Forum entwickelt, zu dem alle reisen, das aber seine Aufgabe, Kriege zu verhindern, nicht erfüllt.
Der Zerfall Jugoslawiens führte zu einem blutigen Krieg. In Georgien und Moldau unterstützte Russland die Separatisten in Abchasien und Transnistrien und drängte sich dann als Vermittler in den Friedensverhandlungen auf, um seinen Einfluss im postsowjetischen Raum zu verteidigen. OSZE-Beobachter waren in Berg-Karabach und im Donbass präsent, aber in beiden Fällen konnte ihre Anwesenheit keinen Frieden sichern. Der Helsinki-Mechanismus war auch nach dem Zerfall der Sowjetunion machtlos, Einfluss auf die russische Politik zu nehmen. Russische Demokratie-Aktivisten beschwerten sich beim Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE über Wahlfälschungen und das Gesetz über „ausländische Agenten“, das in Warschau ansässige Büro erkannte die Verstöße an, doch hatte dies keinerlei Einfluss auf die Politik des Kremls.
In der Außenpolitik hat Russland die Helsinki-Abkommen völlig auf den Kopf gestellt. Wladimir Putin betrachtet die offene finanzielle Unterstützung ukrainischer NGOs durch USAID und die politische Unterstützung des Maidan als „subversive Aktivitäten, die auf den gewaltsamen Sturz des Regimes eines anderen Staates abzielen“ und durch die Abkommen verboten sind. In seiner verzerrten Wahrnehmung gibt ihm dies das Recht, den 2014 begonnenen und 2022 eskalierten Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Trotzdem ist Russland weiterhin OSZE-Mitglied und Außenminister Sergej Lawrow tritt bei Sitzungen der Organisation auf.
Die Zukunft der Helsinki-Abkommen
Können die Helsinki-Abkommen wieder zum Rechtsrahmen für den Frieden in Europa werden? Nur wenn Europa (mit oder ohne die USA) so stark wird, dass Frieden für Russland vorteilhafter ist als Krieg. In diesem Fall würde auf dem Kontinent ein neues Kräftegleichgewicht entstehen, das einen potenziellen Konflikt für alle Länder zu gefährlich machen würde.
Heute hat Wladimir Putin allen Grund zu glauben, dass Macht und die Androhung ihrer Anwendung ein wirksames Instrument zur Durchsetzung seiner Interessen sind. Solange die Europäische Union militärisch schwach bleibt, Russland aggressiv ist und die USA generell bestrebt sind, sich aus Europa zurückzuziehen, sind Versuche, die Helsinki-Abkommen wiederzubeleben oder neue zu schaffen, zum Scheitern verurteilt. Zunächst muss ein Kräftegleichgewicht hergestellt werden, das Russland dazu zwingt, seine expansionistischen Bestrebungen aufzugeben, und dann muss dieses Gleichgewicht schriftlich festgehalten werden.
Die wahre historische Bedeutung der Helsinki-Abkommen besteht darin, dass sie die Menschenrechte zu einem Faktor der internationalen Beziehungen gemacht haben, die Menschenrechtsbewegung in die Weltpolitik eingebunden haben und ihre Anliegen mit der der Sicherheitspolitik verknüpft haben. Ihre Deklarierungen haben unerwartet an Kraft gewonnen.
Die Helsinki-Abkommen haben die Welt verändert, aber nicht so, wie es damals die Diplomaten erwartet hatten, sondern so, wie es die Menschenrechtsaktivisten wollten. Darin liegt die wichtigste historische Lehre aus den Ereignissen, die sich vor 50 Jahren in Helsinki zugetragen haben.
Heute wird dieser Ansatz von allen Seiten in Frage gestellt. Nicht nur von autoritären Regime, sondern auch von Rechtspopulisten in demokratischen Ländern. Trumps transaktionaler Ansatz ist ebenso wenig mit einem umfassenden Friedensvertrag auf der Grundlage gemeinsamer Werte vereinbar wie Putins Expansionismus. Realismus und Idealismus können Frieden und Fortschritt nicht getrennt voneinander, sondern nur in Kombination gewährleisten. Die Menschenrechte als Wertgrundlage der internationalen Beziehungen werden heute so stark auf die Probe gestellt wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr.
Der Krieg in der Ukraine hat den „Helsinki-Frieden“ in Europa begraben. Selbst ein Einfrieren des russisch-ukrainischen Krieges wird Europa keine dauerhafte Sicherheit bringen. Die Annexion ukrainischer Gebiete ist weder mit dem Wortlaut noch mit dem Geist der Schlussakte vereinbar. Russlands Mitgliedschaft in der OSZE ist heute ein absoluter Widerspruch in sich.
Wenn es Europa (oder dem Westen insgesamt) jedoch gelingt, ein echtes militärisches Gleichgewicht mit Russland herzustellen, ohne die Helsinki-Prinzipien aufzugeben, und wenn das Putin-Regime in eine systemische Krise gerät, könnten die Helsinki-Abkommen die Grundlage für die Wiederherstellung der Gerechtigkeit bilden. Sicherlich gibt es hier zu viele „Wenns“, aber sowohl die Geschichte der Helsinki-Schlussakte als auch die Ereignisse der letzten Jahre zeigen, dass Geschichte unvorhersehbar ist und das Unmögliche Realität werden kann, sowohl im negativen als auch im positiven Sinne.
Dieser Text ist zuerst in russischer Sprache bei mostmedia.org erschienen.
Deutsche Bearbeitung: Nikolaus von Twickel
t
Hat Ihnen unser Beitrag gefallen? Dann spenden Sie doch einfach und bequem über unser Spendentool. Sie unterstützen damit die publizistische Arbeit von LibMod. Wir sind als gemeinnützig anerkannt, entsprechend sind Spenden steuerlich absetzbar. Für eine Spendenbescheinigung (nötig bei einem Betrag über 200 EUR), senden Sie Ihre Adressdaten bitte an finanzen@libmod.de
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Mit dem LibMod-Newsletter erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu unseren Themen in Ihr Postfach.