Die Ambivalenz der Freiheit
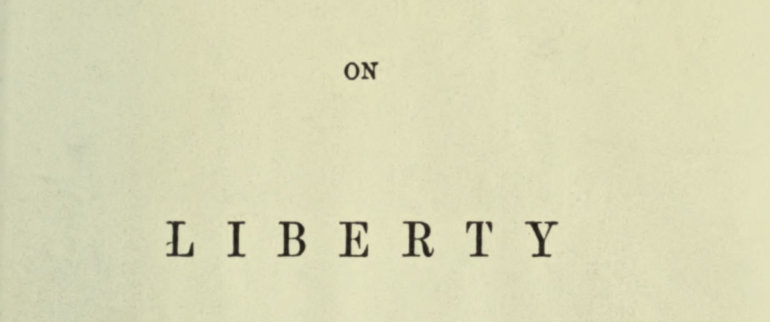
Auch der Liberalismus steht in Gefahr, zur Ideologie zu werden, wenn er die Ambivalenzen der liberalen Moderne ausblendet. Ein Plädoyer für einen reflexiven Liberalismus, der sich bewußt macht, dass die individuelle Freiheit und der Markt in ein gesellschaftliches Regelwerk eingebunden werden müssen.
Ideologien verführen dazu, die Welt nur aus einem einzigen Blickwinkel anzuschauen. Je schwieriger die jeweilige Materie erscheint, desto größer ist auch die Versuchung, die allzu komplexitätsreduzierende Wirkung solcher paradigmatisch klar, aber simpel strukturierten Denkmuster zu nutzen. Diese Gefahr macht vor dem Liberalismus nicht halt. Richtig, die Freiheit ist ein Glück und die Voraussetzung anderer Werte. Aber wo ihr Licht scheint, gibt es auch Schatten. Wer von den Zumutungen, Nöten und Spannungen nichts wissen will, die sich für den Einzelnen wie für die Gemeinschaft der Vielen mit der Freiheit verbinden können, tut ihr einen Bärendienst. Ambivalenzen gilt es als Probleme anzuerkennen und anzunehmen. Mit ihnen gut umzugehen, erfordert politische Klugheit, Fähigkeit zum Abwägen und Bereitschaft zur Fehlerkorrektur – ganz im weiteren Sinne des berühmten Satzes von Karl Popper über alles Leben als Problemlösen.
Die grundlegende Ambivalenz der Freiheit findet ihren Widerschein darin, dass ein gewisser, oft sogar ostentativ zur Schau getragener Liberalismus zum guten Ton gehört, der Befund aber dennoch treffend erscheint, dass die Menschen die Freiheit fürchten. Die Verheißung der Freiheit zum Beispiel, dass jeder Mensch sein Leben in die eigene Hand nehmen kann: Sie ist etwas für fähige, zupackende, optimistische Gemüter. Als Abwehrrecht gefasst, wie im klassischen Liberalismus üblich, braucht man über die Vorzugswürdigkeit der Freiheit nicht zu streiten. Sie bedeutet Abwesenheit von Zwang, von Unterdrückung, von Bevormundung, die uns davon abhalten würden, „einen Lebensplan, der unseren eigenen Charakteranlagen entspricht, zu entwerfen und zu tun, was uns beliebt“, wie es John Stuart Mill formulierte.
Diese „negative Freiheit“, wie Isaiah Berlin sie nannte, überwindet einen letztlich feudalen Typus von Abhängigkeit. Sie entlässt den Einzelnen in variable Kooperationsnetze wie den Markt, aus denen Kritiker freilich wiederum eine – wenn auch ganz andere – Form von Abhängigkeit entstehen sehen. Diese Freiheit jedenfalls verbindet sich mit dem Auftrag zu Selbsterkenntnis, Selbstentfaltung und vor allem Selbstverantwortung; folglich mit der Bürde, als autonomes Wesen Entscheidungen unter Unsicherheit treffen und die Folgen der eigenen Fehler tragen zu müssen. Ist das ein Argument gegen die Freiheit? Sicher nicht. Das alles gehört zum Leben. Doch offensichtlich ist neben dem Appetit auf Autonomie auch die Sehnsucht, in einer organisierten Ordnung aufgehoben zu sein, im Menschen angelegt.
Auch politische Freiheit ist ambivalent
Die individuelle Freiheit birgt auch die Möglichkeit, sein Glück zu machen und reich zu werden: Solange es um die Chancen geht, ist jeder gern dabei, aber wenn das Risiko zur Debatte steht, dass man scheitert und verarmt, lässt die Begeisterung nach. Doch ohne die Gefahr eines Scheiterns gibt es keine Gelegenheit zum Erfolg. Diese Spannung auszutarieren, sodass es nicht beim Entweder-oder bleibt, ist die Forderung an den Sozialstaat: Er muss so gebaut sein, dass er zwar keine Hängematte bietet, aber Menschen im Notfall auffängt, ohne sie im Behördendickicht verloren gehen zu lassen.
Selbst die politische Freiheit ist für den Einzelnen ambivalent. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut, kaum jemand möchte nicht mitbestimmen können. Freilich kann sich in den kollektiven Entscheidungsverfahren der Massengesellschaften das Individuum wenig Hoffnung machen, der entscheidende Wähler zu sein, dessen Votum den Ausschlag gibt. Das kann Frustration stiften. Auch das ist indes kein Argument gegen die Freiheit, denn ohne sie hätte der Bürger im Kollektiv erst recht nichts zu sagen. Der Filz, die in unfreien Staaten üblichen Seilschaften und Klientelbeziehungen – sie sind gewiss nicht befriedigender. Aber diese Spannung gebietet, das System der politischen Partizipation derart mit Rückkopplungen zu versehen, dass die Stimme des Wählers, der nicht der Mehrheit angehört, nicht verloren ist. Auch Minderheiten haben Rechte und müssen Gehör finden.
In gesellschaftlicher Betrachtung gehen die Ambivalenzen der Freiheit noch weit über solche psychologischen Momente hinaus. Hier bekommen wir es mit den komplexen Auswirkungen des individuellen Tuns auf soziale Abläufe und Strukturen zu tun. So erzieht die Freiheit, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen, im guten Fall zu Selbstverantwortung und zur Sorge für alles, was man beeinflussen kann. Im schlechten Fall jedoch zu Egoismus und Vereinzelung. Darunter leidet das soziale Kapital: das Vertrauen, die Kooperation, der Zusammenhalt. Die individuelle Freiheit, womöglich reich zu werden, verleiht der Gesamtwirtschaft eine wirtschaftliche Dynamik, von der im Idealfall die Masse profitiert. Doch sie vermag auch Gier und Geiz zu schüren, den Wettbewerb auszuhebeln und die materielle Ungleichheit so zu vertiefen, dass eine allgemeine moralische Korruption zum Spaltpilz der Gesellschaft wird.
Man muss nicht alles tun, was man darf
Nur ist auch das noch kein Argument gegen die Freiheit: Wie alle Erfahrung mit illiberalen Staaten lehrt, ist in einem Gemeinwesen, in dem die Freiheit des Einzelnen wenig gilt, die moralische Korruption bei weitem ärger. Die Herausforderung für die „offene Gesellschaft“, wie Popper das nicht-kollektivistische, die Individuen ins Zentrum stellende und schützende Gemeinwesen nannte, besteht deshalb vor allem darin, eine Ordnung zu schaffen, die aufeinander ausrichtet, was nicht von selbst immer schon harmonisch ist. Den Prüfstein für alle politischen Maßnahmen, die diesem Zweck dienen, bietet die individuelle Freiheit selbst: Wird sie erweitert und besser abgesichert, oder wird sie am Ende unabsichtlich oder absichtlich beschnitten?
Die individuelle Freiheit von staatlichem Zwang, das Grundprinzip der negativen Freiheit, steht an der Wurzel allen Fortschritts. Aus dieser Einsicht folgt die grundsätzliche Empfehlung, es mit einer ergebnisorientierten politischen Steuerung, die allzu leicht einer „Anmaßung von Wissen“ (Friedrich August von Hayek) gleichkommt, möglichst nicht zu übertreiben. Steckt darin nicht aber ein Angriff auf die Demokratie? Keineswegs. Man muss nicht alles tun, was man darf: Die Legitimität demokratischer Kollektiventscheidungen schließt die Freiheit ein, Dinge nicht kollektiv zu planen und sie stattdessen spontaner Koordination zu überlassen. Je mehr kollektiv geplant und gesteuert wird, desto weniger Raum gibt es für die Initiative der Einzelnen und desto weniger stehen spontane, unvorhergesehene Entwicklungen offen. Dieser Zwiespalt hat sein Gutes. Die Spannung zwischen politischer Steuerung im Staat und spontaner Koordination in der Zivilgesellschaft und auf den Märkten kann dazu beitragen, dass das eine das andere in Schach hält und vor Exzessen bewahrt. Und deshalb schrieb Popper: „Wir brauchen die Freiheit, um den Missbrauch der Staatsgewalt zu verhindern, und wir brauchen den Staat, um den Missbrauch der Freiheit zu verhindern“.
Mehr Informationen zur liberalen Moderne und ihrem Verhältnis zu illiberalen Denktraditionen finden Sie auf www.gegneranalyse.de, einem Projekt von LibMod.
![]()
Hat Ihnen unser Beitrag gefallen? Dann spenden Sie doch einfach und bequem über unser Spendentool. Sie unterstützen damit die publizistische Arbeit von LibMod.
Wir sind als gemeinnützig anerkannt, entsprechend sind Spenden steuerlich absetzbar. Für eine Spendenbescheinigung (nötig bei einem Betrag über 200 EUR), senden Sie Ihre Adressdaten bitte an finanzen@libmod.de
Verwandte Themen
Newsletter bestellen
Mit dem LibMod-Newsletter erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten zu unseren Themen in Ihr Postfach.






